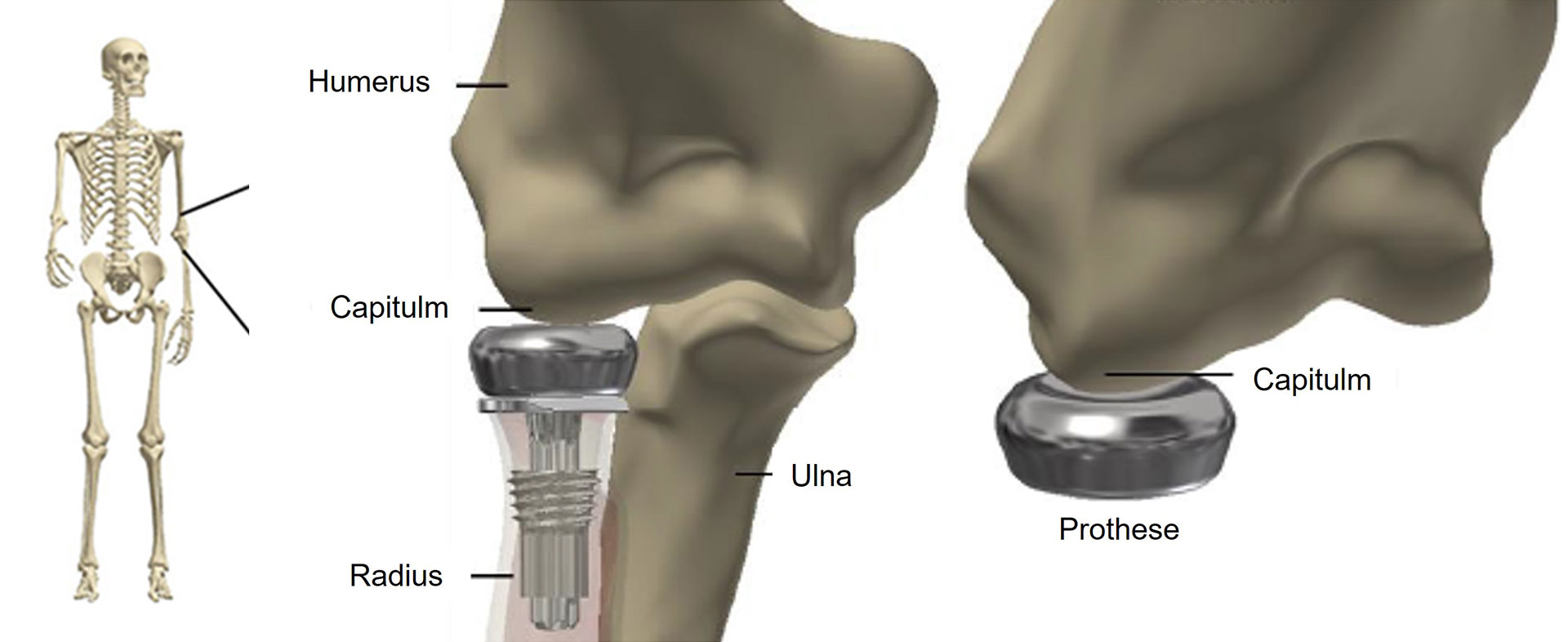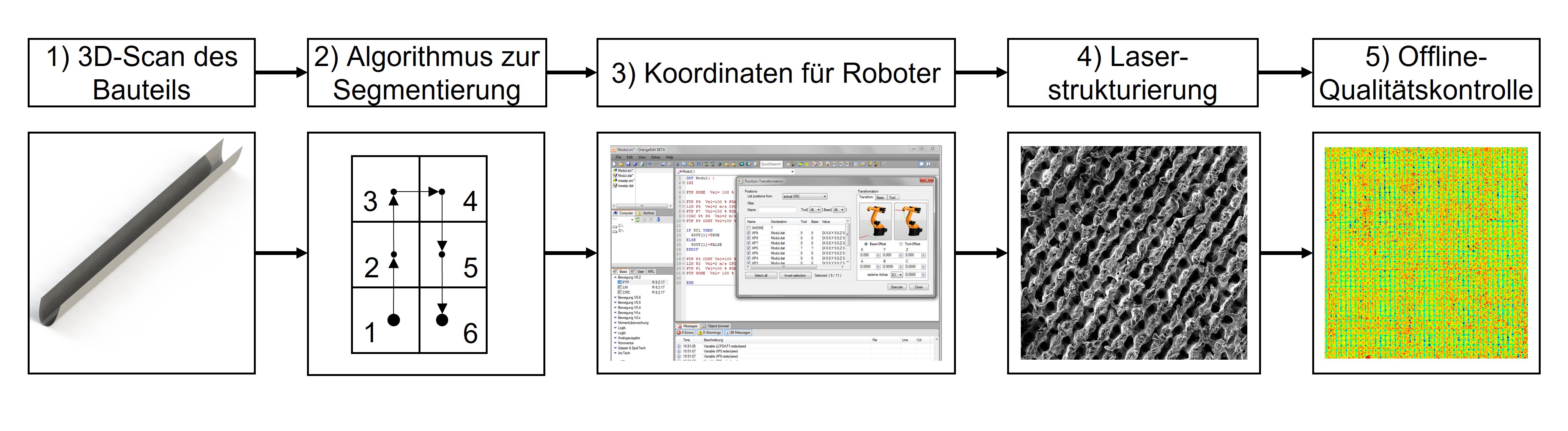Die Reinheit und Perfektion von Siliciumwafern bildet die Grundlage für immer kleinere und gleichzeitig leistungsfähigere elektronische Geräte. Trotz größter Sorgfalt bei den Produktionsschritten vom Wafer bis zum fertigen Chip sind Kontaminationen mit unerwünschten Elementen unvermeidlich.
Diese Verunreinigungen dürfen keinesfalls in das elektronische Bauelement gelangen. Um das zu verhindern, bindet man sie an Sauerstoffagglomerate im Inneren der Wafer. Obwohl das Verhalten dieser Sauerstoffverbindungen umfangreich untersucht ist, war bisher keine Labormethode verfügbar, um die Bildung und die frühen Stadien der Sauerstoffagglomeration unter prozessnahen Bedingungen zu beobachten. Hier setzte das Projekt an. Ziel war es, nachzuweisen, dass diese Agglomerate mittels Röntgenbeugung messbar sind. Außerdem sollten weitere theoretische Ansätze zur Ermittlung ihrer Größe und Dichte entwickelt werden. Die Anforderungen für solche Messungen sind anspruchsvoll. Die Sauerstoffverbindungen sind nur wenige Nanometer groß und entstehen bei etwa 1000 °C. Röntgenstrahlen erkennen die Agglomerate über deren ausgedehntes Verzerrungsfeld im Wirtsgitter und können deren Entstehung darstellen. Da hochenergetische Röntgenstrahlung auch Maschinenteile durchdringen kann und unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen ist, ist sie für eine Untersuchung während des Produktionsprozesses besonders geeignet.


rechts: Siliciumwafer mit 300 mm Durchmesser
Am Lehrstuhl für Kristallographie und Strukturphysik der Universität Nürnberg-Erlangen steht ein spezielles Labor mit Hochenergie-Röntgenquellen zur Verfügung. Hier wurde im Rahmen des Projektes ein geeigneter Hochtemperaturofen entwickelt und gebaut. Die Experimente mit Röntgenstahlung zeigen, dass die Intensität der gebeugten Röntgenstahlung zunimmt, je mehr und größere Sauerstoffagglomerate im Wafer entstehen. Die Machbarkeit von in-situ-Untersuchungen im Labor zur Bildung von Sauerstoffagglomeraten in Silicium bei prozessnahen Bedingungen konnte damit demonstriert werden.