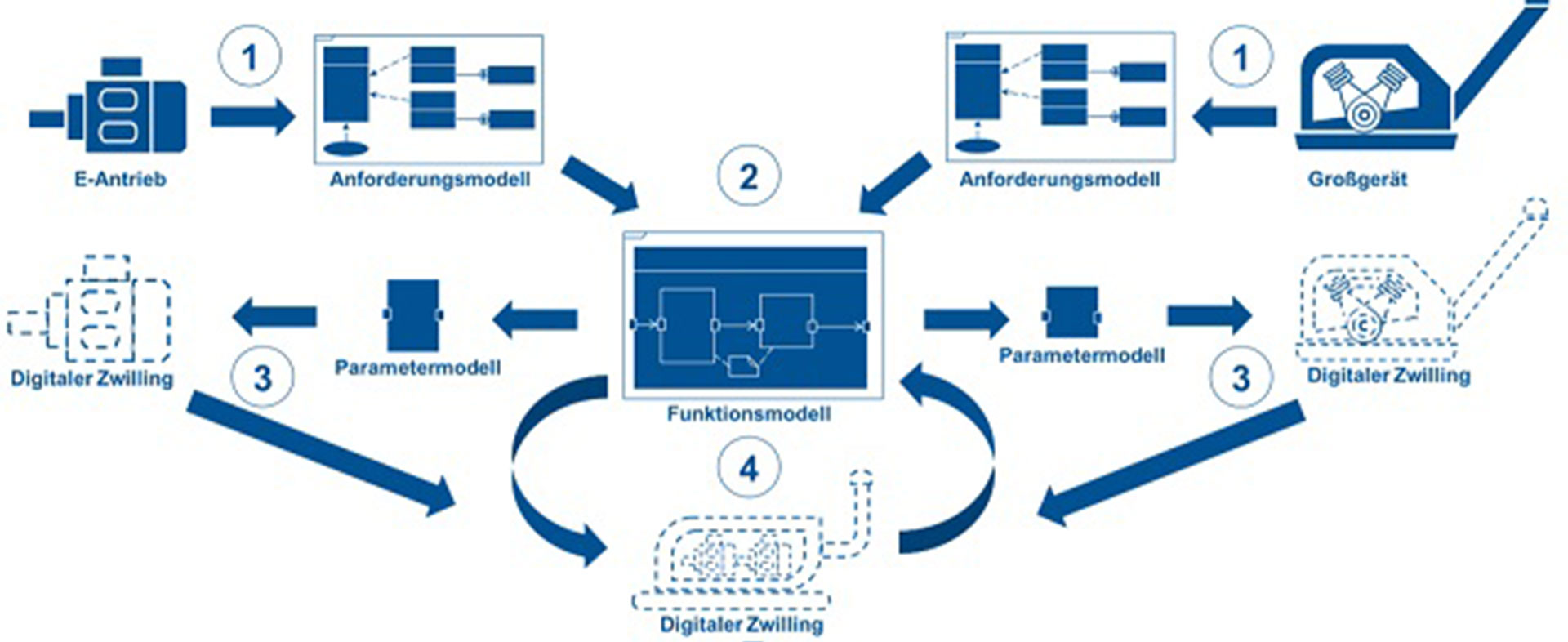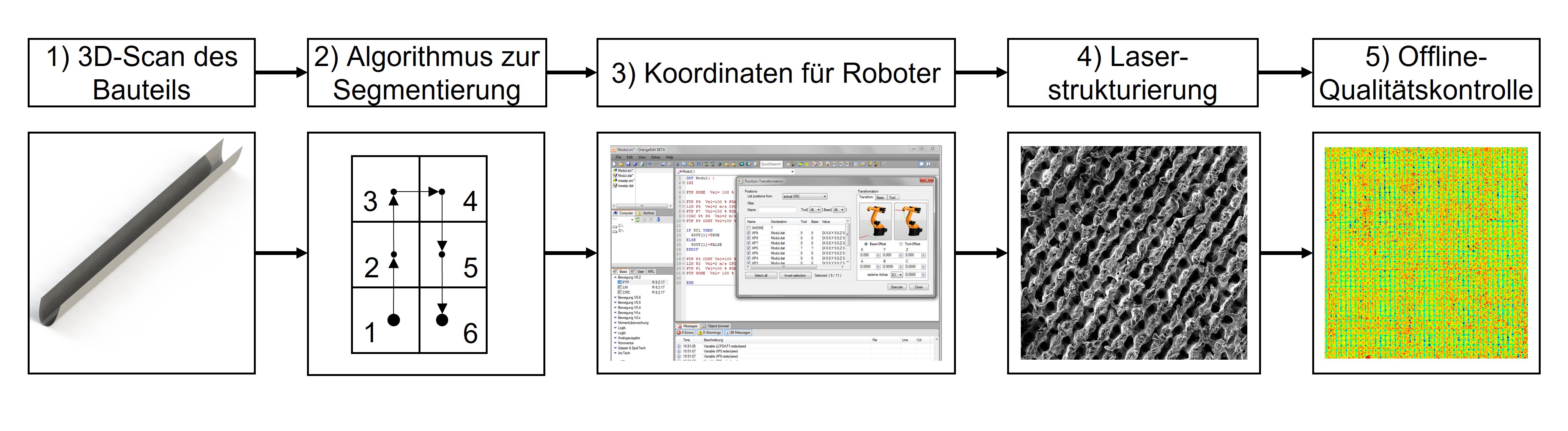Mit dem Projekt sollten die Lebensdauer und die Auslösezuverlässigkeit von Fahrzeugsicherungen bei Konstantstrom- und bei Impulsstrombelastung genauer bestimmt und die Ergebnisse mit vorhandenen theoretischen Berechnungen verglichen werden.
In den heutigen Fahrzeugen hat sowohl die Zahl, die Komplexität, als auch der Stromverbrauch der elektrischen Komponenten laufend zugenommen, und nach dem Stand der Entwicklung ist hier bisher auch keine Trendwende abzusehen. Das Ergebnis ist ein Anstieg der elektrischen Verbindungen und ihrer Leiter-Querschnitte, was naturgemäß eine unerwünschte Zunahme des Fahrzeuggewichts bewirkt. Dem kann u. a. durch eine genauer abgestimmte Absicherung mit weniger Querschnittsreserven bei den Leitungen begegnet werden, wodurch Schmelzsicherungen allerdings an ihre physikalischen Grenzen hinsichtlich der Langzeitzuverlässigkeit stoßen.
![Fahrzeugsicherung ohne Gehäuse vom Typ MiTox, 30 A, Netzstruktur [Quelle: F. Loos, Universität der Bundeswehr München]](https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/1087_02.jpg)
![Fahrzeugsicherung ohne Gehäuse vom Typ MiTox, 30 A, Wärmebild [Quelle: F. Loos, Universität der Bundeswehr München]](https://www.forschungsstiftung.bayern.de/wp-content/uploads/1087_01.jpg)
rechts: Fahrzeugsicherung ohne Gehäuse vom Typ MiTox, 30 A, Wärmebild [Quelle: F. Loos, Universität der Bundeswehr München]
Hinzu kommt, dass immer mehr gepulste Beanspruchungen von Leitungen höhere Anforderungen an eine Absicherung mit Schmelzsicherungen auch wegen ihrer geringeren Auslöseträgheit stellen. Damit ist die Impulsfestigkeit von Sicherungen mit ihrer Lebensdauer-Charakteristik verknüpft.
Aus diesem Grund wurden für das Auslöse- und das Lebensdauerverhalten von Schmelzsicherungen mathematische Modelle entwickelt und die Rechenergebnisse mit umfangreichen Messungen systematisch überprüft. Das Ergebnis ist eine Reihe von Kennwerten, mit denen Sicherungen jetzt detaillierter charakterisiert, für ihren Einsatz besser ausgewählt und für Neuentwicklungen auch besser angepasst werden können.
Besonders untersucht wurde die Impulsfestigkeit. Hier hatte sich gezeigt, dass Sicherungen auch unterhalb ihrer spezifizierten Daten ausfallen, wenn sie nur einer entsprechend großen Anzahl von Impulsen ausgesetzt sind. Der zugrundeliegende Algorithmus konnte empirisch gut beschrieben werden und stellt eine solide Basis für zukünftige Auslegungen in diesem Betriebsmodus dar. Außerdem befähigen das den Hersteller, Neuentwicklungen besser an die Anwendung anpassen zu können.